Das berüchtigte, angebliche Nichtreisenkönnen des Jahres 2020 kam mir gar nicht so vor, denn ich bin gefühlt sehr viel herumgekommen, besonders inhaltlich und in unterschiedlichen geschichtlichen Zusammenhängen. Die permanente Geldlosigkeit und die damit doch real eingeschränkte Möglichkeit zur Ablenkung hat vielleicht bestimmte Kreativitätspotenziale frei gesetzt, die im vielen Unterwegs der vorpandemischen Zeit „verschütt“ gegangen waren: man musste jetzt nicht mehr unbedingt in ein Retreat fahren, um zu schreiben. Und um ernsthafte Denkvorgänge anzutreten, eignet sich besonders das Schreiben, denn — wie Hannah Arendt es in ihrem berühmten Gaus-Interview formuliert hat — „bestimmte Dinge stehen dann fest“. Doch neben dem Schreiben gehörten auch (das Hören von und Schreiben über) Musik, Fotografie und das Zeichnen zu den „verlorenen Mußen“.
Wie ich im Austausch mit anderen Menschen mitbekommen habe, ob aus dem engeren persönlichen Umfeld oder auf Online-Plattformen, war ich nicht der einzige, der sich gerade während des ersten Lockdowns sowie der pseudo-katastrophischen Katerstimmung danach seinem inneren Kind und seinen „echten Leidenschaften“ angenähert hat. Andere hingegen erzählten — wie die in der Einleitung erwähnte Freundin — dass sie quasi ins Haus verordnete, unerwartete Zwangs-Introspektive hart getroffen hat. Eine meiner eigenen, persönlichen Beobachtungen dabei war jedoch, dass mich der Lockdown alles andere als in eine depressive oder destruktive Stimmung gerissen hat: ganz im Gegenteil habe ich verstanden, dass ich in Zeiten der äußeren Krisen über eine enorme Resilienz verfüge. Es ging mir nicht schlecht. Das mag mit den erlebten, äußeren Turbulenzen der 1990er Jahre zu tun haben, und vielleicht auch mit einem gewissen Erfahrungsvorsprung im Umgang mit dem Thema Sterben und Tod — denn in der Todesfurcht steckt ja der innerste Kern der Morbidität der Pandemie. Gerade die von außen — und nicht aus meinem Inneren — eingetretene Krise der Pandemie hat wiederum scheinbar rückgewirkt, dass ich auf einigen inneren Baustellen habe aufräumen können, die mit genau diesen Themen zu tun haben.
Während des vielen Schreibens — und nur ein Bruchteil davon befindet sich auf meinem Frontend, dem Blog — habe ich viel über meinen roten Faden verstanden. Es ist ein wenig wie mit dem Genre des Personal Essays, der in den letzten Jahren in Büchern wie Didier Eribons Rückkehr nach Reims so beliebt geworden ist: der Essay ist wohl tatsächlich das Genre der Krise. Mit Eine Textgattung als Sanitäter hat Deutschlandfunk Kultur einen Beitrag der Sendereihe Essay und Diskurs über das Genre Essay übertitelt und ihn passend in unserer Zeit verortet:
„Der Essay ist ein Krisenphänomen“, das schrieb dort der Literaturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk und meinte damit: In Zeiten des Umbruchs, ja, da liegt das einfach in der Luft. Der suchende, tastende, abwägende Essay, der erkundet gerne unsicheres und neues Terrain mit viel Subjektivität, die vielleicht doch zu allgemeineren Erkenntnissen vordringt. So will es diese Form.
Eine Textgattung als Sanitäter (Deutschlandfunk)
Das noch nie dagewesene, völlig außergewöhnliche Geschehen der sozialen und naturräumlichen Welt während einer Pandemie ist nichts anderes als eine Krise. Diese habe ich versucht, nicht aus den Augen zu verlieren — auch wenn die schiere Masse öffentlich gemachter „Corona-Tagebücher“ zuweilen begann, offensiv langweilig zu werden. Wenn es richtig ist, wie in dem Zitat festgestellt wird, dass es essayistisch möglich ist, über das Persönliche zum Allgemeinen vorzudringen, dann möchte ich mich vorsichtig zum steilen Ergebnis vorwagen, mit einem (zunächst persönlich) erweiterten Weltwissen aus dem letzten Jahr gegangen zu sein. Vielleicht als indirekter „spin-off“ Effekt der Pandemie.
Vom Jahreszeitenzyklus zum Stimmungsbild der Zeit
Doch was davon sollte relevant für andere Menschen sein (können)? „Weil es diese Form so will„, will ich zum Ende also noch etwas zum Stimmungsbild „unserer Zeit“ bemerken, womit ich natürlich keinerlei Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebe. Wenn ich „unsere“ Zeit schreibe, meine ich nicht nur mein, sondern unser Sein-in-der-Welt, denn ich bin ja nicht allein hier; unter Welt (und damit unserer Zeit) ist also das zu verstehen, was Hannah Arendt auch eine Welt des Zwischen genannt hat (ich zitiere der Einfachheit halber aus dem ganz hervorragenden Arendt-Handbuch von Heuer/Heiter/Rosenmüller):
Welt als gemeinsame Welt: Welt ermöglicht Gemeinsamkeit. Umgekehrt ist sie nur als gemeinsame Welt denkbar, wenn Arendt „Welt“ als das „Zwischen“ beschreibt, das sowohl verbindet wie trennt (…). Dies meint sie „in dem gleichen Sinne, in dem etwa ein Tisch zwischen denen steht, die um ihn herum sitzen; wie jedes Zwischen verbindet und trennt die Welt diejenigen, denen sie jeweils gemeinsam ist“ (…). Sofern Welt „zwischen uns“ steht, sind wir nicht unmittelbar miteinander verbunden; da wir uns aber gemeinsam auf unsere „gemeinsame Welt“ beziehen, stehen wir in einem über Sprache, Institutionen usw. vermittelten Kontakt zueinander.
Wolfgang Heuer/Bernd Heiter/Stefanie Rosenmüller (Hrsg.)(2011). Arendt Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, S. 333.
Oft kann einem unsere Welt (oder: Gesellschaft) wie eine zigmillionenfache Ansammlung spleaniger Einzelwesen und Untergruppen vorkommen, die quasi alle in ihren je eigenen, mentalen Ländern und Welten leben und darüber hinaus nicht viel mehr als eine staatlich-administrative Struktur gemein haben: eine Massengesellschaft — und [e]ine „Massengesellschaft“ dagegen sei deshalb so unerträglich, weil hier die Welt diese verbindende und trennende „Kraft verloren hat“ (…). (Ebda.) Hmmm… ob die Welt also ihre verbindende und trennende Kraft verloren hat?
Seit Arendts Tagen sind ja einige Jahrzehnte vergangen. Das Jahr 2020 war auch mit Hinblick auf das Zwischen uns ziemlich bemerkenswert, da nun jede_r Einzelne (unser Massengesellschaft) dazu aufgerufen war, ausgerechnet durch weniger Kontakt mehr für das Gemeinwesen zu tun — und darüber hinaus auch noch global (weil pandemisch) vernetzt zu denken. Ich bin mir unsicher, ob der schwierige Begriff des Zeitgeists zur Beschreibung dieser fast unausweichlichen Kollektiverfahrung der richtige ist: doch es kommt mir so vor, als sei durch die Pandemie so etwas wie der Zeitgeist greifbarer geworden, und zwar über alle einander oft feindselig gegenüberstehenden Lager hinweg (z.B. „Coronaleugnerschaft“ versus „Drostengefolgschaft“). Während normalerweise in der erlebten Zeit eine bestimmte Epoche beim Namen genannt werden kann, die bereits vergangen und dadurch quasi in die Hand nehmbar geworden ist — scheint sich genau dieses in der Gegenwart ereignet zu haben: das Hier und Jetzt wurde über die epidemiologischen Befunde und anti-pandemischen Maßnahmen überstürzt zu einer Art Mini-Epoche, mindestens aber zu einer plötzlichen und gewiss historischen Zäsur, über die fortan immer in ein „vor Corona“ und „seit/nach Corona“ unterschieden werden wird. Deswegen war hinsichtlich der Corona-Zeit auch so oft von einem disruptiven, also wörtlich heraus-reißenden (von lat. disrumpere), Ereignis zu lesen. Hannah Arendts Freund Walter Benjamin hätte wahrscheinlich seine bizarre Freude an unserem disruptiven Moment gehabt und sinngemäß gesagt, die Zeit sei als Fragment aus sich selbst herausgerissen worden.
Aber langsam… Einem jeden Jahresrückblick liegt ein Zyklus zugrunde: dieser beginnt und endet jeweils im Winter. Bietet es sich also nicht vielleicht eher an, sich über den sogenannten Zeitgeist von 2020 ebenfalls zyklische Gedanken zu machen? Und wo schon der Zeitgeist beschworen wird — was war (oder ist) dieser überhaupt, oder wie kann er genauer beschrieben werden? Ich verstehe den Zeitgeist als eine irgendwie hintergründige, aber anwesende Grundstimmung. Doch wie kann eine Beschreibung dieser Grundstimmung zur Möglichkeit beitragen, über unser Sein-in-der-Welt und unsere Welt als unser Zwischen nachzudenken? Das Wort Zeitgeist selbst ist natürlich eine Metapher, also etwas uneigentliches; das passt, weil er sich — sofern es ihn gibt — nicht wie die Temperatur oder der Wind als etwas eigentliches feststellen und messen lässt. Die einzige Möglichkeit, ihn zu erfassen, besteht darin, ihm auf der uneigentlichen Ebene der Sprache nachzustellen, und über die Rück-Übersetzung von Metaphern auf die Ebene der eigentlichen Phänomene — wie zum Beispiel der eigentlichen Coronaviren — zu einer Art Feststellung über die Mentalitäten unserer Zeit zu gelangen.
Um zuerst auf die Frage des Zyklus einzugehen, würde ich nicht direkt aus der Metaphorik der Jahreszeiten als Zyklus von Frühling, Sommer, Herbst und Winter übertragen, der wieder und wiederkehrt. Passender als Ausgangspunkt halte ich eine abgespeckte Variante dieser Metaphorik, nämlich die der zunächst linear gedachten Spanne der individuellen Lebenszeit des kapitalistischen Bildungsromans und der modernen Karriere. Diese linearen Spannen spiegeln sich in unseren millionenfach niedergeschriebenen, verschickten, bewerteten und herunterladbaren Lebensläufen, und haben somit nicht nur mehr mit „real existierenden“ Lebensentwürfen zu tun, sondern auch mit dem verbreiteten Gefühl der allgemeinen, oft genug nihilistischen Todesfurcht, welche so typisch für den ersten Lockdown war: während der Jahreszyklus eine vorhersehbare, einplanbare und regelmäßige Wiederkehr verspricht, sodass der eher unwirtliche Winter als etwas vorübergehendes hinnehmbar und sogar genießbar wird („hyggelig“), war an 2020 gar nichts geplant, geschweige denn gewollt. Selten finden sich in den öffentlichen Meinungen Stimmen, die laut sagen, sie hätten den Lockdown genossen — denn mit Corona schien sich plötzlich und für Viele ganz und gar aus dem Nichts der Tod breitbeinig in den Raum der Öffentlichkeit zu stellen und zu rufen:
„Lockdown!
Game over!
#StayTheFuckHome !
Wenn Ihr Pech habt, nehm’ ich Eure Eltern oder Großeltern mit!
Dann seid Ihr dran!“
Nun findet der Tod generell keinen Platz im Bildungsroman der Industriemoderne, die noch am Nachhallen ist — und mit einer weit um sich greifenden Entchristianisierung bzw. „De-Monotheisierung“ einher gegangen war. Für post-monotheistische Menschen, die vorzeitig auf die Endlichkeit ihres eigenen Lebens, aber auch auf das nun jederzeit drohende Sterbenkönnen ihrer Anderen blicken müssen, gibt es keinerlei zyklische Gewissheit über irgendwelche Wiederauferstehungen oder gar ein ewiges Leben jenseits von „Staub zu Staub“. Monotheistische, religiöse Menschen, die noch etwas mit traditionellen Transzendenzvorstellungen und Eschatologien anfangen können, die also das unlösbare Kontingenzproblem immerhin einigermaßen für sich klären konnten, mag dies weniger betreffen.
Dabei ist es bemerkenswerterweise unwesentlich, welcher der drei großen, abrahamitischen Religionen sie anhängen: für sie bedeutet der Tod keineswegs das Ende aller Dinge und jeden Seins. Auch in nicht-theistischen Traditionen wie dem Buddhismus sind Sterben und Tod kein Horror — sondern als Zwischenzustand (tibetisch „Bardo“) Teil des Lebens; dies wird im Bardo Thödröl, dem sogenannten „Tibetischen Totenbuch“ ergründet, dessen richtige Übersetzung „Befreiung durch Hören im Zwischenzustand“ lautet. Doch diese Fragen betreffen nicht „nur“ die individuelle, sondern auch die gesamtgesellschaftliche Ebene: deshalb ist es auch üblich, dass sich zum Beispiel HistorikerInnen über die Verwendung ganz ähnlicher Begriffe versuchen, eine Vorstellung von einer bestimmten Epoche zu machen.
Natalität, Vitalität oder Morbidität?
Egal, mit welchen Glaubensvorstellungen (oder Nicht-Vorstellungen) man der Frage des Lebens (oder Nicht-Lebens) nach dem Tod begegnet: überträgt man die in Deutschland weit verbreitete Vorstellung der linearen Lebensspanne eines Menschen von der Geburt (bzw. Empfängnis) über die Vita Activa bis zum Tod auf das (vorgestellte) Stimmungsbild der Zeit, so könnte man dieses Bild wie ein großes Triptychon in drei Aspekte gliedern: der erste Flügel zeigte das Geborensein oder die Natalität: unsere Kindheit; im Mittelteil wäre die Lebensblüte oder Vitalität abgebildet: unsere Berufstätigkeit; und drittens, in der Jetzt-Zeit, ginge es um das Lebensende, wo eine Stimmung der Morbidität vorherrschte: Rente, Ende des Systems und Tod.
Natalität oder Geborensein könnte die typische Stimmung für eine Gesellschaft im Aufbruch sein. Deshalb wird auch oft Geburts- und Wiedergeburtsmetaphorik verwendet, wenn Texte verfasst werden, in denen sich Nationen oder andere Gemeinschaften angeblich selbst wahrnehmen — was sie natürlich nie tun, denn immer gibt es eine Autorschaft eines Textes, von dem später behauptet werden kann, er drücke eine Art „Volksgeist“, Zeitgeist oder volonté générale aus. Dementsprechend tragen zahlreiche Bücher so metaphorische — und genauer betrachtet: pathetische und vermarktbare — Titel wie „The Birth of Modern Turkey“ (Handan Nezir-Akmese), „Bulgarische Wiedergeburt“ (Nikolaj Gentschew), „Die Geburt der modernen Welt“ (Christopher A. Bayly) und dergleichen mehr. Natalität, Geborensein und Aufbruch scheinen mir das genaue Gegenteil vom gegenwärtigen Zeitgeist zu sein.
Lebensblüte oder Vitalität dagegen würde ich für eine angebrachte, nun aber hoffnungslos verbrauchte Metapher halten, um die Zeit zu beschreiben, die der Pandemie direkt voraus gegangen war: eine Zeit der Prosperität, der „Fresswellen“ und des Wirtschaftswachstums, in der es um ständige Aktivität, Unterwegssein, Wachstum, Betriebssamkeit und erfolgreiche Karrieren ging — auch wenn der Lack im Prinzip schon längst ab war, um es nicht weniger metaphorisch zu ergänzen.

Dass es so wie bisher ohnehin nicht wird weitergehen können, unterstrichen sowohl die Schrillheit der sogenannten „Klimaleugnerinnen“, als auch die aufsehenerregende Tatsache, dass der Zeitgeist zuletzt massenhaft Kinder und Jugendliche auf die Straßen trieb, denen längst instinktiv klar war, dass die fetten Jahre vorbei sind.

Nachdem das alte und verbrauchte „Normalnarrativ“ ewiger Vitalität, ständigen Wachstums und Prosperität zuletzt in den „Roaring Nineties“ (Joseph E. Stiglitz) noch einmal verheerende Hochkonjunktur hatte, ist diese Erzählung heute längst ein Fall für den Schrotthaufen. Die neuen Erzählungen werden Themen wie die australischen Waldbrände von nie dagewesenen Ausmaßen, amerikanische, türkische, ungarische und unzählige andere Trash-Regierungen, die immer wieder aufs Neue ertrinkenden Hundertschaften im Mittelmeer, die sich ausweitenden, sogenannten inhabitablen (unbewohnbaren) Zonen, die Hitze- und Dürreperioden bis hinauf nach Skandinavien und Sibirien verhandeln müssen, um glaubwürdig zu sein. Vielleicht sehen also Bilder unserer Zeit eher so aus wie die folgenden drei Schnappschüsse aus Berlin (2019):
[2] Das ausgetrocknete Tempelhofer Feld: nachdem es einfach gar nicht mehr regnete, stellte sich jemand ein Sofa unter diese Eiche, wo das Sofa auch monatelang stehenblieb
[3] Zwei Passanten in Kreuzberg betrachten zwei ausgebrannte SUVs, von denen das Signal ausgeht, dass diese Luxusgüter nicht geschätzt werden.
Nein: Vitalität ist nicht die vorherrschende Stimmung — eher ist es Morbidität. Ihr wisst/Sie wissen schon, was damit gemeint ist: jene Stimmung, die Anfang 2020 von den Fernsehbildern aus Oberitalien ausging, wo Militärfahrzeuge eingesetzt werden mussten, um die vielen Leichen abzutransportieren. Um nun also erneut von der sprachlichen Metaphorik zu konkreten Bildern zu gelangen, könnte man versucht sein, in den Memento Mori- und Vanitasbildern des Mittelalters, der Frühen (Europäischen) Neuzeit und des Barock nach Parallelen zu suchen: in ihnen geht es schließlich explizit um Morbidität. Doch es gibt sowohl Gemeinsamkeiten, als auch sehr große Unterschiede zwischen unserer Zäsur und den alten Gemälden, die über eine gewisse Aussagekraft über den damaligen Zeitgeist verfügen — wenn man sie, wie gesagt, mit der eben zurückliegenden Periode der Jetztzeit vergleichen möchte: im Normalnarrativ des ständigen Wachstums und der ständigen Prosperität, welcher der kapitalistischen Ideologie inhärent ist, kommt keine Aufforderung vor, sich ein Lebtag mit der eigenen Sterblichkeit zu beschäftigen. Worte wie Sterblichkeit und „Übersterblichkeit“ haben erst seit Corona Hochkonjunktur, behandeln aber das Thema nur als statistischen Faktor.

Das heißt natürlich nicht, dass die Alten keine Angst vor dem Sterben hatten. Auf den alten Bildern, besonders des Barock, kommen zum Beispiel keine Leerstellen vor: keine weißen, nicht am Gemälde beteiligten Flecken, was in der Kunstgeschichte als horror vacui — als Angst vor der Leere — bezeichnet wird. Zwar blenden die Kunstwerke des Barock den Tod ständig ein, doch gleichzeitig lassen sie nicht zu, dass die Frage des Jenseitigen unbeantwortet bleibt oder gar in Zweifel gezogen wird: das Christentum sitzt in jener Zeit relativ fest im Sattel; es war die Zeit der Hexenverbrennungen. Der Tod bedeutet in den alten Glaubenssystemen also keineswegs Leere, sondern Übergang.
Die Welt ist ein Fenster
Ein Vanitasbild des niederländischen Malers Joos van Cleve trägt den Titel Der heilige Hieronymus im Gehäus (ca. 1520-25): es zeigt den alten Hieronymus, wie er mit einem ehrlich verzweifelten Blick über seinen christlichen Büchern hängt, umgeben von Gegenständen der Wissenschaft und des Glaubens. Im Hintergrund, an der Wand zwischen den zwei Fenstern, hängt ein verzierter Rahmen mit der Aufforderung Cogita mori: „Bedenke dein Sterben“. Dem entsprechen die Symbole der Sanduhr, der erlöschenden Kerze, des Totenschädels und des Glasgefäßes, das gefährlich nahe an der Kante des Fensterbretts steht und jederzeit droht, herunterzufallen und zu zerbersten, woraufhin sich die Flüssigkeit (das rationierte Leben) verlaufen würde. Das Fenster im Rücken des alten Hieronymus zeigt die Welt, aber scheint gleichzeitig die Geschichte des Christentums anzudeuten: es sind sowohl europäische Stadthäuser, als auch Ruinen, antik wirkende Bögen, für Mitteleuropa exotische Dromedare aus dem Mittleren Osten sowie Turban tragende Männer abgebildet.

Das Leben als Fenster: das erinnert an den Titel und Liedtext Bu Dünya Bir Pencere (Diese Welt ist ein Fenster) des türkischen Sängers Emin İgüs:
| Dereler akar gider Taşları yıkar gider (ey güzel) Bu dünya bir pencere Her gelen bakar gider (ey güzel) | Bäche fließen und vergehen waschen Steine, ihre Steine vergehen (Hey Schöne_r) Diese Welt ist ein Fenster Alle die kommen schauen und gehen (Hey Schöne_r) |
| Dere akar bulanık Köpüğünden alalık (ey güzel) Ha bu ışıklı dünya Oldu bize karanlık (ey güzel) | Der Bach fließt trübe Schäumt vor Schlamm (Hey Schöne_r) Ha diese strahlende Welt Wurde uns (zur) Finsternis (Hey Schöne_r) |
| Gidelim değirmene Öğütelim unları (ey güzel) Güneşe çevirelim Bu karanlık günleri (ey güzel) | Lass uns zur Mühle gehen Mehl lass uns mahlen (Hey Schöne_r) Zur Sonne lass uns wenden Diese finstren Tage (Hey Schöne_r) |
Der Zeit mehr Leben hinzufügen
Ich erwähnte im Prolog, dass ich diese Betrachtungen zum Jahr 2020 vielleicht nicht unbedingt tröstlich fände — aber erbaulich, und dass letzteres mehr (Wert) sei als ersteres. Verständlicherweise wird es schwer möglich sein, die genannte „Beschissenheit der Dinge“, welche gewissen Dingen innewohnt, schön zu reden und dadurch Trost zu finden. Doch was soll an all dem jetzt eigentlich erbaulich sein, nachdem ich dem Zeitgeist nun eine generelle Morbidität attestiert habe? Nun, ich finde es immerhin erbaulich, dass Zeiten wie diese zu eigen ist, dass sich die Perspektive ändern kann, dass sich neue und verschiedene Perspektiven bilden können, zum Beispiel auf unser einfach hingenommenes, aber völlig zu hinterfragendes Weltbild des linearen Bildungsromans voller erfolgreicher Karrieren, die am Ende drohen, in Nihilismus abzustürzen. Und verschiedene Perspektiven sind, zumindest laut Hannah Arendt, nötig, um Welt entstehen zu lassen:
„Welt“ stellt sich überhaupt nur durch die Verschiedenartigkeit der Perspektiven auf sie her. „Nur wo Dinge, (…) von Vielen in einer Vielfalt von Perspektiven erblickt werden“ gibt es „weltliche Wirklichkeit“ (…). Und umgekehrt: „Eine gemeinsame Welt verschwindet, wenn sie nur noch unter einem Aspekt gesehen wird; sie existiert überhaupt nur in der Vielfalt ihrer Perspektiven“(…).
Arendt Handbuch, S. 333.
Dies dürfte ganz besonders für eine Welt in Metamorphose (Ulrich Beck) gelten, wo das Leben im Kokon vielleicht noch nicht so recht weiß, was es ist und was es wird. Passenderweise habe ich beim Fertigstellen dieses Textes eine Art zweites Weihnachtspaket mit Postkarte von meiner Tante erhalten, der dieser Epilog auch gewidmet ist. Wie der Text der Postkarte feststellt, sind Perspektiven veränderbar. Wer zum Beispiel gerade noch in der Fresswelle feststeckt, muss das nicht bleiben:
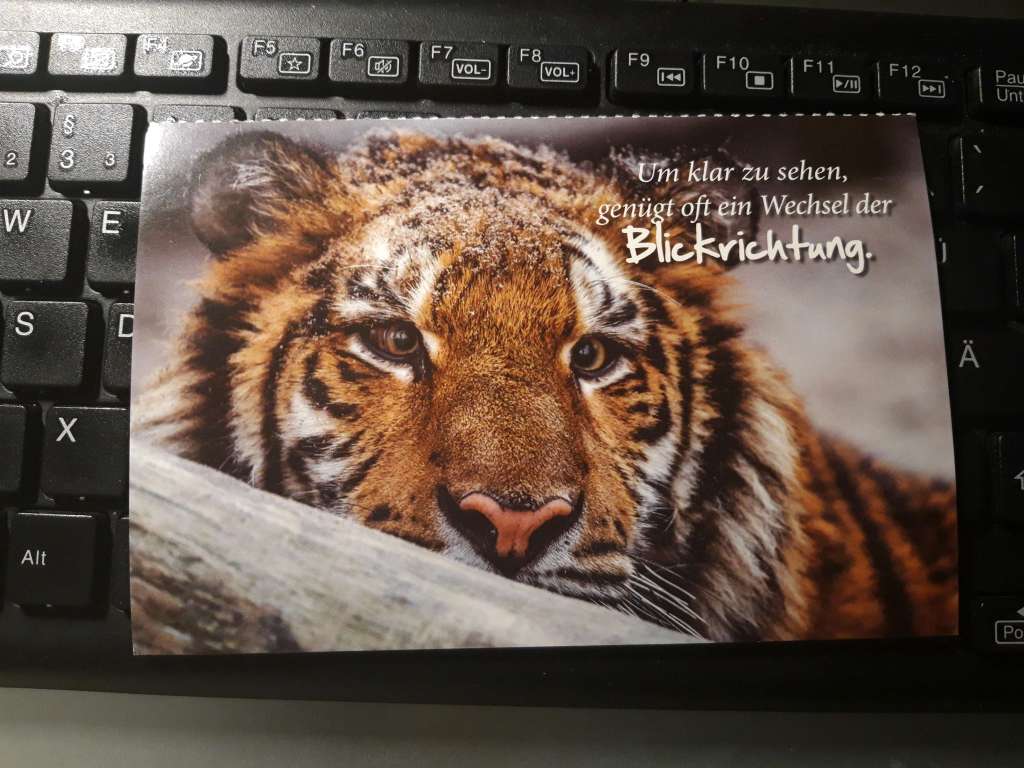
Und ganz zum Schluss möchte ich meiner in der Einleitung erwähnten Freundin noch einen Vers aus dem Buch einer anderen, bereits verstorbenen Freundin anfügen — da sie vom Gefühl geplagt wird, man habe ihr in diesem zwielichtigen Jahr des Zwischenzustands Zeit weggenommen:
Man kann seinem Leben nicht mehr Zeit hinzufügen, aber seiner Zeit mehr Leben.
Autorin: Melanie Götz. Zitiert nach der früh verstorbenen Weggefährtin und Mit-Freiwilligen Meike Schneider (Dies., 2006: Ich will mein Leben tanzen. Tagebuch einer Theologiestudentin, die den Kampf gegen Krebs verloren hat. Mit einem Vorwort von José Carreras. Medienverband der Evangelischen Kirche im Rheinland gGmbH: Düsseldorf, S. 124.
And now, I call it a year.




Hinterlasse einen Kommentar