Die radikalen Veränderungen, die jedes Jahr um diese Zeit in der gemäßigten Zone eintreten — dunkle, kurze und kalte Tage ohne Chlorophyll — bewirken bei vielen Menschen starke Gemütsveränderungen. Äußerlich regieren die Unwirtlichkeiten, gegen die freilich hin und wieder ausgebrochen wird: Urlaub in den Tropen, Gaudi auf dem Weihnachtsmarkt, Shopping-Exzesse vor dem großen Potlatsch und so fort. Innerlich ziehen sich viele Menschen in eine Art Gemütlichkeit zurück. Sie schauen Filme an, hören Musik, lesen (angeblich) Bücher, zünden sich Kerzen an, haben es sich hyggelig eingerichtet.
Soweit das Klischee.
Tatsächlich werden die meisten rastlos über einen oder mehrere ihrer Touchscreens schmieren; denn die Wahrheit ist, dass wahrscheinlich nie mehr Menschen in schlecht verstandenen Süchten gefangen waren als sie es heute sind. Eine wachsende Zahl, womöglich ganze Generationen, dürften Schwierigkeiten haben, sich überhaupt noch länger als fünf Minuten auf irgendwas zu konzentrieren. Bücher lesen ist unter diesen Umständen ein ziemlich unangepasster, disziplinierter Akt zwischen Verstand und Widerstand.
Auch ich habe es gerade gemütlich, lese kein Buch, schmiere über einen neuen Touchscreen — und schaue nebenher Jeanne Dielman, einen belgischen Film aus dem Jahr 1975 von Chantal Akerman.
Die Hauptprotagonistin Jeanne Dielman ist eine verwitwete, zirka 40-jährige Alleinerziehende in einer belgischen Stadt, wahrscheinlich Brüssel, denn es wird Französisch und Flämisch gesprochen (später sehe ich, dass der französische Originaltitel um 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles erweitert ist — also ja, es ist Brüssel). Ihr 16-jähriger Sohn Sylvain, wenn auch wallonischer Herkunft, geht auf eine flämische Schule und hat sich einen flämischen Akzent zugelegt — wahrscheinlich für seinen Freund Jan, in den er womöglich verliebt ist, was aber nicht explizit gemacht wird. Jeanne arbeitet nebenher und von zu Hause aus als Hure. Sie wird in drei Tagen von drei Freiern besucht, was auch der gespielten Zeit des Films entspricht. Sie führt dabei ein extrem ordentliches, diszipliniertes Leben mit den immer gleichen Routinen und Abläufen.
Es ist Winter, es wird wenig gesprochen. Der Sohn Sylvain irritiert daher umso mehr mit seinen Brechthaften Ansprachen über Gechlechterverhältnis und Sex, worauf Jeanne zwar antwortet, aber vor allzu größeren Komplikationen die Nachtruhe einleitet. Mutter Jeanne entgleiten zum Ende des Filmes hin allmählich ihre strengen Routinen: Am dritten Tag schließlich greift sie nach getaner Arbeit zu einer Schere. Fast sachlich tritt sie an die Bettkante und tötet damit ohne viel Federlesens einen Freier. Danach sitzt sie einige Minuten mit blutigen Händen am Glastisch in ihrer aufgeräumten Wohnung und tut gar nichts mehr. Hier endet der Film im Abspann.
Ich denke, dass ein so handlungsarmer und wortkarger, aber nichtsdestotrotz beeindruckender Film heute wenige Chancen hätte, zu entstehen. Doch mir geht es nicht so sehr um den Film und seinen Plot, sondern eher um die vergangene Normalität, die durch die Aufnahmen scheint.
Obwohl der Film fünf Jahre vor meiner Geburt erschienen ist und in einem urbanen Milieu Belgiens spielt, erscheint vieles wiedererkennbar. Da ist die Art der Badezimmer- und Küchenfliesen, eine davon mit eingebauter Seifenschale; die Zubereitung des Essens; der Stil der Einrichtung, die teils an Gelsenkirchener Barock (der glänzende Schlafzimmerschrank), teils an Relikte aus noch älteren Geschmacksmoden erinnert (die opulente Sesselgarnitur im Wohnzimmer). Dann sind da die Industrieprodukte, die verwendet werden: Einmal scheint Jeanne beim Putzen der Badewanne nach dem Putzmittel Ata zu greifen: ein Scheuermittel, das auch in den 1980er Jahren zur Standardausstattung unseres Haushaltes gehörte. Als die Schuhe des Sohns Löcher haben, werden sie nicht etwa „ersetzt“, wie man es heute tut, sondern zum flämelnden Schuster gebracht, der sie zum nächsten Nachmittag repariert. Kauft Jeanne Wolle für ihr Strickset, wird sie in der Wollabteilung des Kaufhauses von einer Fachverkäuferin bedient — was mich an die großen Strick- und Nähbedarfabteilungen alter Kaufhäuser in den 1980er Jahren erinnert, die es meines Wissens so nicht mehr gibt; sie braucht Nachschub an Wolle, weil sie ihrem Sohn einen Pullover strickt. Zum Einkaufen führt sie eines jener praktischen Netze aus Schnur mit sich, die heute aus irgendeinem Grund verschwunden sind, zumindest aber Vintage-Status haben. Wenn sie Gemüse einkauft, werden die Porreestangen in altes Zeitungspapier eingewickelt. Die Post von der in Kanada lebenden Schwester Fernande wird in einem echten Postamt abgeholt, das in Belgien rote Signalfarbe trägt.

Je mehr Dinge sich wiedererkennen lassen, desto weniger ähnelt die Wirklichkeit des Films noch dem, was uns heute umgibt. Abends schaltet Jeanne für einen begrenzten Zeitraum das Radio ein, während ihr Sohn liest; einen Fernseher gibt es nicht. An den Straßenrändern parken zwar Autos — aber es sind wesentlich weniger und auch kleinere als in heutigen Städten Mittel- und Westeuropas. Zwischendurch möchte man Jeanne zurufen, sie möchte doch um Himmels willen die Vorhänge nicht so nah am Gasherd aufhängen und vielleicht noch einmal über einfarbige Tapeten fürs Wohnzimmer nachdenken. Alles in allem wundert man sich, wie es möglich ist, ein so schlichtes und schmuckloses Leben zu führen.
Ich lese über Chantal Akerman und Jeanne Dielman nach.
Der Film wird wohl seit den 2010er Jahren als feministischer Meilenstein stark neurezipiert und für seinen Umgang mit Zeit und Handlung ausgezeichnet. Handlung besteht hauptsächlich aus weiblichen, präziser gesagt: hausfräulichen Alltagshandlungen, die früher im Genre Film keine vergleichbare Beachtung gefunden hätten. In der Tat: Jeanne beim minutenlangen Kneten von Hackfleisch mit Zwiebelwürfeln oder bei der vollumfänglichen Prozedur des Panierens zweier Schnitzel zuzusehen — das ist ungewöhnlich und lässt ein wenig an Hannah Schweiers absolut hervorragenden Dokumentarfilm 80.000 Schnitzel denken. Zwischendurch wird ihr von einer Nachbarin ein Baby in einer Trage zur vorübergehenden Aufsicht vorbeigebracht, wobei das Kind eher wenig Zuwendung erfährt. Die Sorgen der Nachbarin, die von ihren hausfräulichen Pflichten ermüdet ist, hört sich Jeanne distanziert an.
Ich zitiere zur Rezeption von Jeanne Dielman aus Wikipedia eine Passage mit einem Zitat von Chantal Akerman:
Chantal Akerman äußerte, der Film sei eine Reaktion auf „eine Hierarchie der Bilder“ im Kino, die einen Autounfall oder einen Kuss „höher stellt als das Abwaschen … Und das ist kein Zufall, sondern hängt mit der Stellung der Frau in der sozialen Hierarchie zusammen … Die Arbeit der Frau kommt aus der Unterdrückung, und was aus der Unterdrückung kommt, ist interessanter. Man muss deutlich sein, wirklich.“ Mit der Art der Kameraführung und langen Einstellungen habe sie „vermeiden [wollen], dass die Handlung an hundert Stellen geschnitten wird, um genau hinzusehen und respektvoll zu sein.“
Eigentlich war es gar nicht meine Absicht, diesen Film in diesen Text einfließen zu lassen, denn mein Ausgangspunkt war ein Buch, das seit zirka dreißig Jahren in meinem Regal steht und zusammen mit einem zweiten Buch ähnlicher Herkunft gewissermaßen zu meinen Grundbüchern gehört. In einer Aufräumaktion hatte ich es kürzlich wieder in der Hand. Es trägt den deutschen Titel Insel der Seefahrer (1977), ist 1976 in Original auf Englisch unter dem Titel The Navigator erschienen und wurde vom australischen Autor Morris L. West verfasst. Es darf wohl als seichte Lektüre bezeichnet werden, obwohl ich mir einbilde, damals ein paar horizonterweiternde Dinge durch das Buch gelernt zu haben.

Grob zusammengefasst stellt ein norwegisch-polynesischer Kapitän namens Gunnar Thorkild eine sehr gemischte Crew abenteuerlustiger Menschen zusammen, um mit dem Schiff Frigate Bird eine sagenumwogene Insel im Südpazifik zu entdecken, die von großen polynesischen Seefahrerlegenden zum Ende ihres Lebens aufgesucht wird. Die Crew findet schließlich die Insel, erleidet aber Schiffbruch, einige Todesfälle und ist fortan auf der Insel gefangen. Von einer Robinsonnade unterscheidet es sich einerseits dadurch, dass die Crew zwar isoliert, die Einzelnen aber nicht einsam sind. Zweitens entfaltet sich eine komplexere Dynamik als etwa bei Robinson Crusoe oder in Marlene Haushofers Die Wand: Die Gemeinschaft spaltet sich in ein Ober- und Unterdorf auf. Im Kollektiv finden zwar ähnliche Lernprozesse wie für einzelne Gestrandete in Robinsonnaden statt, im Grunde wird aber die Geschichte einer Neubegründung der Menschheit erzählt, die sofort alle alten Fehler wiederholt.
Das für meinen damaligen Bewusstseinszustand Unerhörte an dem Buch war erstens, dass es unter den Angeheuerten eine Frau gab, die „ab und zu ein bisschen Hasch“ rauchte, was der sie anheuernde Kapitän Gunnar Thorkild aber nicht ernsthaft schlimm zu finden schien. In meinem Umfeld gehörte das Wort Haschisch damals zur Kategorie Rauschgift und war mit Heroin und anderen, todbringenden Drogen gleichzusetzen. Zweitens gab es ein schwules Pärchen, was offenbar ebensowenig zu den Todsünden gerechnet wurde, obwohl an einer Stelle eine Warnung vor dem schlechten Einfluss auf Jugendliche formuliert wurde, was der Leser aber als ungerecht empfindet. Drittens schienen politische Grenzen in dem Buch nicht die geringste Rolle zu spielen, wenn ich mich richtig erinnere, und die Crew war völlig divers zusammengewürfelt; außerdem schien es möglich, norwegisches und polynesisches Seefahrerwissen zu verbinden, erfahrungsdurstig in die Welt hinauszustapfen und Neues zu entdecken — und das war ganz nach meinem Geschmack. Die erste Lektüre ist zirka 30 Jahre her, aber vielleicht lese ich es bald noch einmal.
Es gibt etwas, das den Film Jeanne Dielman und das Buch Insel der Seefahrer verbindet — und es ist nicht das Textliche, sondern eher das Kontextuelle. Das mag jetzt vielleicht weit hergeholt erscheinen, denn es hat auch mit meiner Beziehung zum Buch Insel der Seefahrer, seinem Fundort, dem zweiten Grundbuch und noch ein paar Klassenfragen zu tun. Der Gesamtzusammenhang besteht vielleicht in einer Art Suche nach der verlorenen Zeit.
Bei Jeanne Dielman ist es der Eindruck, auf eine fast indiskrete Art in der Vergangenheit anderer Leute herumzuwühlen und Dinge zu beobachten, um die es der Regisseurin nicht hatte gehen können: Die bereits beschriebene Langsamkeit war zwar einer Absicht geschuldet, doch quasi im um Jahrzehnte verzerrten Nebeneffekt sezieren die ruhigen Kameraeinstellungen und langsamen Szenen aus heutiger Sicht eine Zeit, in der man sich selbst womöglich für sehr modern hielt, die aber aus heutiger Sicht enorm vorgestrig erscheint. Viele der Rituale und Gewohnheiten wirken nicht nur wie aus einem anderen Jahrhundert (ja: Jahrtausend) — sondern sie sind es.
Beim Buch Insel der Seefahrer sind es für mich eher die Umstände, unter denen das Buch zu mir gekommen ist, die eine verlorene Zeit beschreiben. Theoretisch war es schon immer da — nur blieb es von mir unentdeckt und ungelesen, bis ich irgendwann in dem Alter war, mich vor einen Bücherschrank zu setzen, darin zu wühlen, Bücher zur Hand zu nehmen, sie interessant zu finden und schließlich zu lesen. Es soll ja Menschen geben, die es unbedenklich finden, wenn Kinder an jener Schwelle, an der Bücher wirklich interessant werden könnten, anstatt zu lesen vor Konsolen und Flachbildschirmen sitzen und „zocken“ — um womöglich nie mehr ernsthaft ein ganzes Buch zu lesen, weil sich die kognitive Ruhe und Konzentration nie entfalten konnte. Mich jedenfalls erschreckt diese Entwicklung zutiefst. Vielleicht ist es auch ein bisschen schrullig, so etwas zu schreiben.
Wir sind wahrscheinlich immer schon auf der Suche nach der verlorenen Zeit — doch das Kind, das sich an einem mitteleuropäischen Wintertag von Langeweile getrieben vor einen Bücherschrank setzt und neue Welten entdeckt, gehört vielleicht ebenso in ein vergangenes Jahrhundert wie Jeanne Dielman, Gunnar Thorkild und seine Crew. Waren die 1970er Jahre in den späten 1990er Jahren noch eine Art Disco-Trend einer gar nicht so weit zurückliegenden Zeit, so liegen sie in den 2020er Jahren fast schon außerhalb des Vorstellbaren — abgesehen von Jeannes Erinnerungsposten, die ein 1980 geborener Mensch wiedererkennen kann.
Zuletzt muss ich noch an diesen merkwürdigen Bücherschrank in unserem alten Haus in Franken denken, der stilistisch auch in Jeanne Dielmans Wohnung gepasst hätte — dort wahrscheinlich in ihren Hausgang. Es war eher ein Kommode in schmucklosem Nachkriegs(?)design, deren obere Fächer mit Glasschiebetüren versehen waren, während der untere Teil Schwingtüren aus Holz hatte. Oben befanden sich Sammeltassen und Nippes, unten war alles zugestopft mit Büchern. Letzteres zeigt an, dass in diesem Haushalt damals eher wenig bis gar nicht gelesen wurde. Unter den Büchern befanden sich jüngere Schwarten wie James Clavells Noble House Hong Kong, das im Original 1981 erschienen ist und sich mir nie erschloss; desweiteren fanden sich völlig uninteressante Konsalik-Bücher, religiöse Literatur, Kochbücher und anderes. Ein älteres Buch, nämlich der Antikriegsroman Die Blumen von Hiroshima von Edita Morris (1959, Dt. 1960), hat hingegen sofort mein Interesse geweckt. Es zählt zusammen mit Insel der Seefahrer zu meinen Grundbüchern.

Dass diese Bücher bis heute bei mir sind und einen besonderen Platz einnehmen, stellt eine Verbindung zu meiner viel zu früh verstorbenen Oma Olga her, von der diese Bücher stammen dürften. Schlägt man Die Blumen von Hiroshima auf — ein berührendes Buch über Hiroshima und amerikanisch-japanische Beziehungen kurz nach dem Atombombenabwurf — findet man gleich die Angabe, dass es im Bertelsmann Lesering erschienen ist, dem späteren Club Bertelsmann. Insel der Seefahrer hingegen ist eine Lizenzausgabe des Deutschen Bücherbundes, der 1992 durch den Club Bertelsmann übernommen wurde.
Nun war Olga eine Flüchtlingsfrau aus der UdSSR, Arbeiterin in einer Fabrik für Leuchten, gleichzeitig Landwirtin und prinzipiell nur am arbeiten. Es hieß früher immer achtungsvoll, sie täte nichts anderes, als sich abzurackern. Aus dem Februar 1990 (als sie starb) ist mir der Satz in Erinnerung geblieben, sie habe ihr Leben lang gearbeitet und sich dann gleich hingelegt, um zu sterben — und so war es auch, denn ihr Todesurteil kam zeitgleich mit ihrem Renteneintritt. Neben ihrer Religion muss sie aber ein gewisses Interesse für Bücher gehabt haben, denn sie war Mitglied im Bücherbund, weshalb regelmäßig dünnblättrige Buchkataloge kursierten, aus denen Bücher ausgesucht und bestellt werden mussten. Tat man das nicht, so die Regeln der Mitgliedschaft, wurden einem einfach Bücher zugeschickt. Ich vermute, das erklärt die Herkunft der Konsalik-Bücher und James Clavells Noble House Hong Kong. Vielleicht haben aber auch meine beiden Grundbücher diesen Hintergrund.
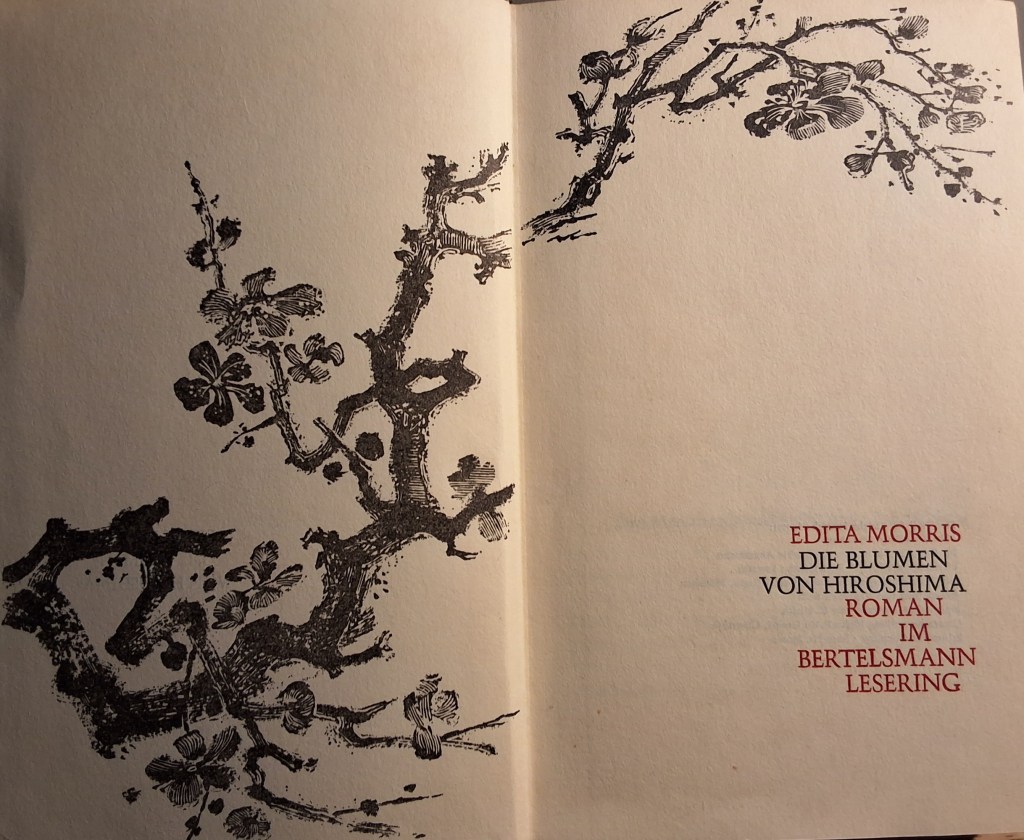



Hinterlasse einen Kommentar